
NEUROWISSENSCHAFTEN: DER NEUE GRENZBEREICH (Teil 1)
Der Mensch trügt nicht. Wie funktioniert unser Gehirn? Wir werden mit Forschungsergebnissen und Entdeckungen bombardiert, aus denen schnell plakative Schlüsse gezogen werden. Aber die Fragen werden nicht weniger.Mit dieser Ausgabe beginnen wir eine Artikelreihe, die uns in die Welt der Kognitionswissenschaften einführt: eine Revolution, die der Galileis nicht nachsteht.
MICHELE DI FRANCESCO, der Philosophie des Geistes in Pavia lehrt, erklärt uns, dass wir zunächst einmal wissen müssten, wie wir mit ihnen umgehen.
„Region der moralischen Entscheidungen entdeckt.“ „So entstehen Erinnerungen.“ „Emotionen im Gehirn fotografiert.“ Das sind einige Schlagzeilen aus einem noch ziemlich neuen und äußerst vielversprechenden Grenzbereich der Forschung: den Neurowissenschaften. Sie sind aus der Erforschung des Nervensystems entstanden und entwickeln sich heute zu einem immer komplexer und interdisziplinärer werdenden Forschungsgebiet. Es reicht von den nicht wahrnehmbaren Bewegungen der Augen bis hin zum Problem der Verortung (und des Wesens) des Bewusstseins. Die Neurowissenschaften erfreuen sich heute großer Aufmerksamkeit, nicht nur wegen der enorm hohen Investitionen vieler Regierungen, allen voran die der Vereinigten Staaten, in einschlägige Forschungsprojekte, sondern auch wegen der unerschöpflichen Faszination, die das Geheimnis unseres Geistes auf die Menschen ausübt.
Unsere Artikelreihe erhebt nicht den Anspruch, die vielfältige Landschaft der Neurowissenschaften erschöpfend darzustellen. Wir wollen nur versuchen, besser zu verstehen, was für eine Revolution gerade stattfindet. Sie ist „mit der des Galileo durchaus vergleichbar“, meint Michele Di Francesco, der Rektor der Hochschule IUSS in Pavia. Da die Medien fast immer über einzelne Entdeckungen berichten, lassen wir uns oft mehr von den vereinfachenden Botschaften und dadurch geweckten Phantasievorstellungen beeindrucken, als von ihrem tatsächlichen Wert. Auch deswegen werden Ergebnisse der Neurowissenschaften gerne mit der sich daraus ableitenden Neurokultur verwechselt. Letztere ist eine weit verbreitete anthropologische Sichtweise, der zufolge der Mensch ein Hirnsubjekt und das Gehirn der Ort des Selbst sei. Wie der Nobelpreisträger Francis Crick es Anfang der Neunziger Jahre formulierte: „Du bist nichts anderes als ein Haufen Neuronen.“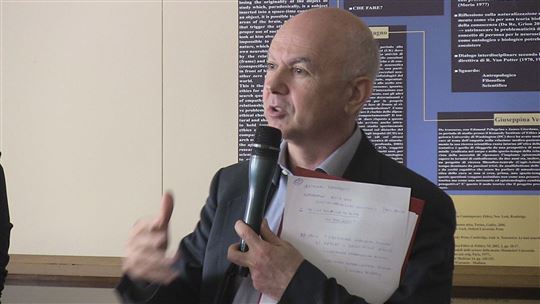
In eben jenen Jahren spürte der Schriftsteller Tom Wolfe „den eisigen Hauch, der vom heißesten Bereich der akademischen Welt ausgeht“, und kommentierte: „Wir leben in einer Zeit, in der die Wissenschaft einen Gerichtshof ohne Berufungsinstanz darstellt. Aber was diesmal auf dem Spiel steht, ist die Natur unseres kostbaren inneren Ichs.“ „Diesmal“ heißt, dass wir an einem nicht zu versäumenden geschichtlichen Wendepunkt stehen. Aber gerade angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, laufen wir Gefahr, uns nicht mit den Ergebnissen der Wissenschaft auseinanderzusetzen, weil wir befürchten, dass uns die geheimnisvolle Größe des Menschseins entschwinden könnte. Daher müssen wir angesichts der intellektuellen Herausforderung der Neurowissenschaften vor allem „wissen, wie wir mit ihr umgehen sollen.“
Herr Professor Di Francesco, warum vergleichen Sie den heutigen Stand der Neurowissenschaften mit der Revolution des Galilei?
Damals wurden die Grundlagen für eine Revolution unserer Kenntnis der physischen Welt gelegt. Heute stecken wir mitten in einer Revolution, die es uns ermöglicht zu verstehen, wie der menschliche Geist funktioniert. Und zwar zum ersten Mal in der Geschichte. Doch das verdanken wir nicht nur den Neurowissenschaften. Sie sind Teil des großen Unternehmens der Kognitionswissenschaften, zu denen die Kognitionspsychologie, die künstliche Intelligenz, die Linguistik und noch weitere Disziplinen gehören. Die Revolution in der Hirnforschung begann in den 60er und 70er Jahren, als der Ansatz des Behaviorismus sich als nicht mehr ausreichend erwies, demzufolge das Gehirn lediglich eine Black Box ist, die man nicht erforschen kann, und das einzige, was wissenschaftlicher und experimenteller Forschung zugänglich wäre, die Beziehung zwischen dem von außen einwirkenden Reiz und der Reaktion des Menschen ist.
Heutzutage hat die Hirnforschung einen Höhepunkt erreicht, auch dank der Neurotechnologien, die die Hirnkartierung ermöglichen. Welches Modell ist derzeit vorherrschend?
Heute ist das von einem großen Teil des gegenwärtigen Materialismus vertretene neurozentrierte Modell das bekannteste und anerkannteste. Dieses führt die geistigen Erscheinungen auf die Nervenaktivität des Gehirns zurück und beschränkt sie auf das, was sich innerhalb des Schädels abspielt. Am Ende stimmt das Personsein dann mit dem Besitz eines Gehirns überein. Aber auch andere Modelle gewinnen an Autorität, die auf unterschiedliche Weise auf einem Begriff des Geistes aufbauen, der nicht nur Produkt von Mechanismen innerhalb des Organismus ist, sondern ein dynamisches System, das sich der Welt öffnet und Teil von ihr ist. Wie auch immer, der springende Punkt ist, dass wir vor dem Versuch stehen, die Grenzen des Geistes neu zu umschreiben. Wie können aus neurochemischen Mechanismen Bewusstsein und Denken entstehen? Das ist das Rätsel, das die Kognitionswissenschaften lösen wollen, unter denen die Neurowissenschaften derzeit die spektakulärsten sind.
Warum beeindrucken die Neurowissenschaften am meisten?
Ihre Anziehungskraft beruht auf der Art der Vermittlung, die sie ermöglichen. Sie können nun einmal ohne große Mühe populärwissenschaftlich aufbereitet und vereinfacht dargestellt werden. Wenn ich ein schönes Bild aus einer funktionellen Magnetresonanztomographie zeige, auf dem die Aktivität einer Hirnregion zu sehen ist, und daneben schreibe: „Region der moralischen Entscheidungen entdeckt“, dann ist das eine Nachricht, die viel Aufmerksamkeit erregt. Das muss nicht heißen, dass die Entdeckung nicht auch tatsächlich von Bedeutung ist. Man muss nur immer darauf schauen, was genau sie beweist. Auf jeden Fall liegt der wahre Grund, warum die Neurowissenschaften so viel Aufmerksamkeit genießen und auch verdienen, darin, dass sie der Grenzbereich sind, der die größten Fortschritte verspricht.
Klinische Fortschritte?
Ja, vor allem. In Anbetracht der zunehmenden Alterung der Bevölkerung wird die Frage der neurodegenerativen Krankheiten zu einem immer zentraleren Thema. Unser Leben dauert immer länger, aber die Zeitspanne, die wir „hinzugewinnen“, verbringen wir oft unter Umständen, die zu akzeptieren und zu bewältigen uns schwerfällt. Wir wollen keine hundert Jahre leben, wenn wir während der letzten zwanzig nicht mehr zurechnungsfähig sind. Wir wollen gut leben. Es geht nicht darum, das Leben zu verlängern, sondern seine Qualität zu erhöhen. Deswegen setzt man so sehr auf die Neurowissenschaften. Gleichzeitig wird das Leben des Menschen immer stärker durch seine kognitiven Fähigkeiten, durch sein Denkvermögen bestimmt. Daher die Gleichung: Je besser wir den Geist kennen, desto besser kennen wir den Menschen.
Die Forschungsergebnisse als solche fallen nicht einfach mit einem Welt- und Menschenbild zusammen, auch wenn manche Interpretationen das behaupten. Was sind ihrer Meinung nach die Daten der gegenwärtigen Entdeckungen, die wir nicht übersehen dürfen?
Die erste Erkenntnis ist, dass das Bewusstsein weniger zentral ist, als wir je gedacht haben. Denn unser Tun besteht aus unzähligen sub-personalen Prozessen. Der größte Teil unseres kognitiven Lebens besteht aus automatischen Mechanismen, aus Verarbeitungsprozessen, von denen wir nichts ahnen, weil sie im Unterbewusstsein ablaufen. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir in Gedanken versunken Auto fahren und trotzdem bei einem Stoppschild anhalten. Oder wenn wir dieses Gefühl der geistigen Leere bekommen, weil wir ein Zimmer betreten, aber mit unseren Gedanken woanders sind. Dann halten wir plötzlich inne, weil der Automatismus unterbrochen wurde, und fragen uns: „Was wollte ich eigentlich hier?“ Trotzdem kann man daraus nicht ableiten, dass das Bewusstsein nicht zählt. Hier liegt der ungerechtfertigte Sprung des Reduktionismus.
Welche anderen wichtigen Ergebnisse gibt es?
Diejenigen, die mit der Innenschau zu tun haben. Wir vertrauen instinktiv auf unsere Fähigkeiten der Selbsterforschung. Wir glauben, dass wir, wenn wir in uns hineinschauen, eine Erkenntnis gewinnen, die über jeden Zweifel erhaben ist. Dagegen widersprechen die heutigen Ergebnisse gerade dem Modell des französischen Philosophen Descartes, wonach wir unseren Geist besser kennen als die Außenwelt.
Woher wissen wir, dass die Innenschau irreführend ist?
Ich möchte zwei Beispiele nennen. Einerseits zeigen die Forschungen über unsere Entscheidungsprozesse, dass die Gründe, die wir anführen, um unser Handeln zu rechtfertigen, häufig nicht die wahren sind. Von der Ethik über die Wirtschaft bis zur Politik öffnet sich ein neues Forschungsgebiet, bei dem die Neurowissenschaften uns helfen zu verstehen, wie unsere rationalen Entscheidungen (ohne dass wir es merken) von unbewussten, automatischen „Vorurteilen“ beeinflusst werden, die sich auch der Innenschau entziehen. Das zweite Beispiel betrifft die Kenntnis des Ichs. Nicht nur kann man das Descartes’sche Ego, die res cogitans, nicht durch Introspektion finden, wie Hume bereits bemerkt hatte. Sondern wir wissen heute auch, dass unser inneres Wissen über uns selbst genauso fehlbar ist wie das über die Außenwelt. Die Wissenschaft sagt uns, dass die psychologischen und neurologischen Prozesse nicht dem entsprechen, was wir uns vorstellen. Etwas wahrnehmen heißt nicht, sich eine statische Darstellung der Außenwelt zu schaffen. Sich an etwas erinnern heißt nicht, sich ein statisches Archiv von festen und unveränderlichen Erinnerungen schaffen. Beide Prozesse sind dynamisch und an die Entwicklung unserer Beziehung zur Welt gekoppelt. Genauso wie das korrekte logische Denken eine Aktivität ist, die unbedingt den Beitrag der Gefühlswelt erfordert, und so weiter.
Sie haben die italienische Öffentlichkeit mit dem in Amerika debattierten Modell des „erweiterten Geistes“ bekannt gemacht, das von den Philosophen Andy Clark und David Chalmers 1998 formuliert wurde, also mit einem Begriff von Geist, der nicht auf eine persönliche und phänomenologische Dimension der Selbsterfahrung verzichtet. Es wirft die Frage auf: Wo endet der Geist und wo beginnt die übrige Welt?
Dieses Modell setzt mental und zerebral in ontologischer und erkenntnistheoretischer Hinsicht nicht einfach gleich. Das Subjekt ist eine Mischung aus biologischem Denken und kultureller Potenzierung. Die Neurowissenschaften können uns folglich helfen, die biologische Grundlage immer besser zu verstehen, die es uns ermöglicht, vielfache Ressourcen aus der Umwelt einzusetzen, um unsere Intelligenz zu potenzieren. Aber wir haben bis jetzt keine Antworten auf diese Interaktion; wir wissen nicht, warum das Gehirn so gebaut ist, dass es sich selbst erweitern kann.
Welche Herausforderung stellt sich also?
Das Verständnis der Wechselbeziehung zwischen geistigem Leben und neurophysiologischen Prozessen. Das verbreitetste wissenschaftliche Modell sagt, wenn man das Gehirn wegnimmt, hat man keinen Geist mehr. Aber wenn man eine Person nimmt und all ihre Beziehungen eliminiert, hat man auch keinen Geist mehr (oder jedenfalls keinen echt menschlichen Geist). Ein Kind, das allein aufwüchse, hätte schwerste Störungen, ein völlig anderes Bewusstsein und einen nur bruchstückhaften Geist. Das bedeutet, dass sein Geist, seine Einheit nicht einfach nur vom Gehirn hervorgebracht wird. Wir reden von zwei Polen eines magnetischen Feldes: Wenn wir einen wegnehmen, haben wir kein „halbes Feld“, wir haben einfach nichts mehr.
Was hier auf dem Spiel steht, ist also der Vernunftbegriff als solcher. Wenn man die Vernunft auf die biologische Dimension begrenzt, entsteht das Paradox, dass die Wissenschaft vor allem sich selbst leugnet: Sie würde die Erfahrung „aus erster Hand“ leugnen, welche auch ihr die Erkenntnis vermittelt.
Die Welt ist nicht denkbar, wenn man die allumfassende Dimension des Personseins ausschaltet. Wenn wir eine bestimmte Art materialistischer Begriffe in die Wirklichkeit einführen, dann kommt ein Vorurteil ans Licht: die Idee, die wissenschaftliche Weltsicht liefere uns Beweise, dass es irgendwo eine Beschreibung der Wirklichkeit gebe, die perfekt, völlig klar, unpersönlich und körperlos wäre und auf die das lebendige Prinzip des Menschen zwangsläufig zusammenschrumpfen müsste. Diese Beschreibung soll die „Spannung“ zwischen natürlich und spirituell auflösen, indem sie die persönliche Seite der unpersönlichen einverleibt. Ich persönlich habe den Verdacht, dass diese Spannung zu den kognitiven Grenzen unserer Spezies gehört. Sie ist unauflösbar.
Vielleicht ist sie keine Grenze, sondern das Zeichen einer Größe.
Sie ist eine Spannung, die offenkundig ist, seitdem der Mensch angefangen hat, eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft gründende Weltsicht zu entwickeln. Ich möchte nur einen Punkt hervorheben: Es gibt ein Thema, das ständig wiederkehrt, und das ist die Freiheit. Wir fragen uns, ob wir freier sind als die Mäuse, und antworten mit ja, weil wir mehr Wahlmöglichkeiten haben als sie. Aber wir sagen, dass wir nicht frei im absoluten Sinne sind. Was würde das bedeuten? Dass wir ohne Grund handeln? Ich handele nur aus einem Grund. Ich handele nach Beweggründen, denen ich zustimme.
Die Neurowissenschaften erforschen die „neuronalen Korrelate“, den Gehirnzustand, der mit einer Erfahrung verknüpft ist. Was sagt uns das über die Erfahrung?
Wir könnten sagen, dass uns das nicht weiter bringt, aber das wäre falsch. Die Neurowissenschaft kann und soll sich positiv in die Phänomenologie integrieren, aber ich glaube nicht, dass sie genügt, um sie zu erklären. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wäre es sinnvoll, das Schreiben eines Romans in der Weise zu beschreiben, dass man nur über das spricht, was im Gehirn abläuft? Es besteht eine fortwährende Interaktion mit dem, was ich vor Augen habe. Ich schreibe, streiche etwas, schaue es mir an, gehe wieder zurück. Es entsteht ein größeres System, das mich und das, was ich gerade schreibe, mit einbezieht.
Wenn unsere Lebenserfahrung von Natur aus nicht allein auf eine neuronale Funktion zurückgeführt werden kann, welche Horizonte eröffnen dann diese Korrelate?
Sie bieten außerordentlich große Möglichkeiten, die es in ihren ethischen, politischen und juristischen Auswirkungen und im Hinblick auf unsere Vorstellung von uns selbst zu bewerten gilt. Stellen wir uns vor, ich könnte bestimmte Formen psychischer Störungen identifizieren, die einen ganz bestimmten Gehirnzustand als Korrelat haben. Und nehmen wir an, ich könnte ein Molekül schaffen, das auf diese Störung einwirkt. Das ist von großer Bedeutung. Aber es ist nicht unbedingt die Lösung.
Wieso?
Es kann sein, dass diese Störung, auch wenn sie eine Grundlage im Gehirn hat, aus einem Beziehungsproblem hervorgeht. Wenn ich das Sozialverhalten allein auf neurologische Grundlagen zurückführe, dann führt das zu einer Verarmung der menschlichen Natur. Das ist der Grund, warum man in Amerika unruhigen Kindern Psychopharmaka verschreibt. Es ist viel einfacher, ihnen eine Tablette zu geben, als eine Schule zu schaffen, die in der Lage ist, sie aufzunehmen. Aber ist das recht? Man muss fähig sein, sich diese Frage zu stellen.
Und was antworten Sie?
Ich sage, dass uns der Gedanke nicht gefällt, eine Glückspille zu nehmen, um glücklich zu sein. Aber warum? Vielleicht weil wir eine umfassendere Sicht des Menschen haben. Vielleicht weil es uns nicht reicht, „ein bestimmtes funktionelles Gleichgewicht auf neuronaler Ebene“ zu haben. Andernfalls würde uns die Glückspille vollauf genügen. Aber das Personsein, die menschliche Würde ist etwas anderes. Wir wollen in der rechten Weise glücklich sein.
Welche ist das?
Wir wollen keinen „neuronalen Zustand, der mit der Erfahrung des Glücks übereinstimmt“. Wir wollen ein Glück, das so beschaffen ist, wie es sein soll.
DIE ANFÄNGEBis zum 18. Jahrhundert ist die Forschung über die Funktionen des Gehirns marginal; es gilt als ein Organ mit empfindungslosem Kortex und homogener Struktur. Ende des 18. Jahrhunderts legt Luigi Galvani die Grundlagen für die Erforschung der elektrischen Erregbarkeit der Neuronen. Um 1800 begründet Franz Joseph Gall die Phrenologie, die auf der Vorstellung basiert, dass die Gehirnfunktionen lokalisierbar sind. Zusammen mit Johann Spurzheim „kartographiert“ er das Gehirn. 1861 Paul Broca gelingt eine der ersten Lokalisierungen von Hirnfunktionen: Er entdeckt das Sprachzentrum. 1890 Camillo Golgi entwickelt eine Färbetechnik, durch die er die komplexen Strukturen des einzelnen Neurons sichtbar macht. Santiago Ramón y Cajal formuliert die „Neuronentheorie“, nach der das Neuron als die funktionelle Einheit des Gehirns gilt. (1906 erhalten beide den Nobelpreis.) 1962 Francis O. Schmitt prägt den Begriff „Neurowissenschaften“ und fördert den Zusammenschluss von Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen zur Erforschung des Nervensystems. 1963 John C. Eccles erhält den Nobelpreis für seine Forschungen zur Signalweiterleitung von Nervenzellen. In seinem Buch „The neurophysiological basic of the mind“ führt er die bisherigen Forschungen zusammen. |