
Wenn es das, was man sucht, tatsächlich gibt
Der Genetiker Pierluigi Strippoli (Bologna) erforscht die Ursachen des Down-Syndroms, um den Betroffenen zu helfen, ganz im Einklang mit Jérôme Lejeune, dem französischen Pädiater, der 1959 die Anomalie des Chromosom 21 entdeckt hat.Während heutzutage ein Großteil der Mittel für Pränataldiagnostik eingesetzt wird, um rechtzeitig abtreiben zu können, erforscht der Genetiker Pierluigi Strippoli die Ursachen des Down-Syndroms, um den Betroffenen zu helfen. „Wenn die Natur jemanden verurteilt, ist es nicht Aufgabe der Medizin, das Urteil zu vollstrecken, sondern die Strafe abzumildern“, meint er.
Gut beobachten zu können, ist die wichtigste Fähigkeit, die ein Forscher braucht. Pierluigi Strippoli weiß, dass das keineswegs selbstverständlich ist, weder unter dem Mikroskop, noch mit bloßem Auge. Und dass man so oft die größten Entdeckungen macht. Deshalb ist das das Erste, was er seinen Medizinstudenten beibringt. An den Anfang seines Kurses stellt er immer den Satz des Nobelpreisträgers Alexis Carrel: „Viel Beobachten und wenig Schlussfolgern führt zur Wahrheit; wenig Beobachten und viel Schlussfolgern führt zu Fehlern.“ Strippoli ist Professor für Genetik an der Universität Bologna und leitet das Genom-Labor in der Abteilung für spezialisierte, diagnostische und experimentelle Medizin. Er ist 53 Jahre alt und steht seit vier Jahren an der Spitze eines einmaligen Projektes. Er erforscht die Funktion des Chromosoms 21, das beim Down-Syndrom in dreifacher (statt wie normalerweise in zweifacher) Ausführung vorliegt. Er will herausfinden, was für die Intelligenzminderung verantwortlich ist, die mit der Krankheit einhergeht. „Es gibt nur noch wenige, die über Trisomie 21 forschen. Der einfache Grund dafür ist, dass das wissenschaftliche Interesse und die finanziellen Mittel in die Pränataldiagnostik fließen, die es immer früher und ohne Risiko erlaubt, die dritte Kopie des Chromosoms 21 zu finden“, erklärt Strippoli. Seine Forschung wird dagegen fast ausschließlich durch Spenden finanziert. „Eines von 400 Kindern, und eines von 700 lebendgeborenen, hat Trisomie 21. Man kann das also kaum als einen seltenen Defekt bezeichnen. Unter den genetischen Erkrankungen ist es sogar die häufigste.“ Derzeit leben weltweit etwa 6 Millionen Menschen mit Down-Syndrom. Die Lebenserwartung liegt heute bei mehr als 62 Jahren, während sie in den 70er-Jahren noch bei 25 und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei nur neun Jahren lag. „Das liegt zum einen an verbesserten Lebensverhältnissen, kommt aber vor allem daher, dass es heute möglich ist, das schwerste damit einhergehende gesundheitliche Problem, die Herzfehler zu behandeln. Was wir bis heute noch nicht lösen können, ist das Problem der Intelligenzminderung. Darüber forschen wir, und die Ergebnisse überraschen uns immer wieder.“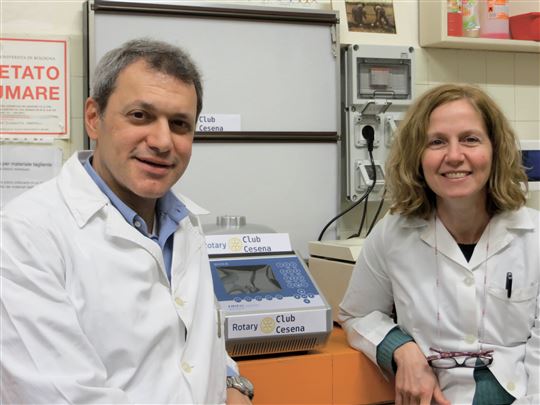
Das kostet ziemliche Mühen und erfordert immer wieder originelle Lösungen. Die internationale Forschungswelt geht derweil in eine ganz andere Richtung. Man braucht nur an die Nachricht aus Island kürzlich zu denken, es sei das erste Land „Down-Syndrom-freie“ Land der Welt. Dort werden aufgrund eines Pränataltestes aus einer Blutprobe der Mutter und da man im Falle eines positiven Testergebnisses auch nach der 16. Schwangerschaftswoche noch abtreiben kann, überhaupt keine Kinder mit Down-Syndrom mehr geboren. Strippoli hält es dagegen mit Jérôme Lejeune, dem französischen Pädiater, der 1959 die Anomalie des Chromosom 21 entdeckt und mehr als 9.000 Kinder behandelt hat. Er meinte: „Wenn die Natur jemanden verurteilt, ist es nicht Aufgabe der Medizin, das Urteil zu vollstrecken, sondern die Strafe abzumildern.“
Nach Ihrem medizinischen Examen 1990 haben Sie sich gleich der Forschung zugewandt. Woher kam Ihr Interesse für Trisomie 21?
Das kam ganz unerwartet. 2011 habe ich Mark Basik, einen befreundeten Onkologen aus Kanada, getroffen und ihm von meinen Forschungen zum Kolonkarzinom erzählt, die ich mit Enzo Piccinini begonnen hatte. Ich erzählte ihm auch von einem Projekt über das Chromosom 21, das einzuschlafen drohte. Es bestand zu wenig Interesse und es gab kein Geld. Er sagte mir, in Paris fände bald eine Tagung über den Stand der Down-Syndrom-Forschung statt, an der auch Ombretta Salvucci teilnehmen werde, eine gemeinsame Freundin, die in engem Kontakt mit der Familie von Lejeune stand. Ich hatte eigentlich kein Interesse an der Tagung, aber schließlich habe ich mich von seinem und Ombrettas Enthusiasmus anstecken lassen und das Flugzeug nach Paris genommen.
Was geschah dann?
Ich war wie vom Blitz getroffen, wie aktuell die Studien von Lejeune noch waren. Er hatte ein paar Theorien aufgestellt, die es wert waren, überprüft zu werden. Dabei muss man bedenken, dass Ergebnisse im Bereich der Genetik normalerweise innerhalb weniger Jahre „überholt“ sind. Mir fiel besonders auf, wie nah er offensichtlich daran gewesen war, das Problem der Intelligenzminderung beim Down-Syndrom zu erklären. Dazu hatte er eine Theorie, die nach seinem Tod 1994 niemand weiter verfolgt hatte. Am letzten Abend der Tagung lud Madame Birthe, die Ehefrau von Lejeune, uns zu sich zum Essen ein. Sie fragte mich, in welchem Bereich ich forsche. Ich murmelte etwas von Chromosom 21 und sie antwortete: „Ja, aber wenn sie die Trisomie studieren wollen, dann müssen sie sich die Kinder anschauen.“ Damit kehrte ich nach Bologna zurück und fragte bei Professor Guido Cocchi an, der sich seit 30 Jahren um die Nachsorge von Down-Syndrom-Kindern im Ospedale Sant’Orsola kümmert. Ich erzählte ihm von meiner Idee, die Forschung von Lejeune wieder aufzunehmen, und dass ich dazu seine Patienten sehen müsse. So habe ich mich dann bei seiner Visite unter die Assistenzärzte und Studenten eingereiht.
Was haben Sie dabei gelernt?
Dass die Behinderung von Menschen mit Trisomie 21 geringer ist, als man denkt. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, was sie aufnehmen, und dem, was sie ausdrücken können. Sie sind völlig bewusst, aber dann holpert etwas. Es scheint eher eine Art organischer Blockade zu sein als ein Defizit der Persönlichkeit. Das hat mich dazu gebracht, der Theorie von Lejeune noch mehr Vertrauen zu schenken. Er war der Meinung, das Down-Syndrom sei eine Stoffwechselerkrankung, die zu einer chronischen Vergiftung der Zellen führt. Davon ausgehend haben wir ein neues klinisch-experimentelles Forschungsprojekt zur Trisomie 21 aufgelegt. 2014, nachdem das Ethikkomitee des Krankenhauses dem Projekt zugestimmt hatte, begannen wir unsere Forschung unter den skeptischen Augen vieler Kollegen.
Sind alle Kollegen in Ihrem Labor an der Forschung beteiligt?
Nein, nur Frau Dr. Lorenza Vitale, eine Studienkollegin von mir. Sie hat mir Jahre später einmal gesagt: „Als du aus Paris zurückgekommen bist, warst du nicht mehr der gleiche. Ich hatte gleich das Gefühl, dass daraus etwas Großes entstehen könnte.“ Heute arbeiten vier weitere Kollegen mit uns, deren Stellen dank Stipendien Jahr um Jahr verlängert werden müssen. Und ein paar Doktoranden, die sich für unsere Arbeit begeistern und uns ein bisschen helfen. Gemessen an den normalen Standards sind wir eine winzige Gruppe.
Worin besteht die Forschung genau? An was arbeiten Sie?
Wir haben zwei Ansätze. Einerseits suchen wir auf der dritten Kopie des Chromosoms 21 die Gene, die für die Intelligenzminderung verantwortlich sind. Lejeune war davon überzeugt, dass unter den 300 Genen des Chromosoms „viele Unschuldige und wenige Schuldige“ sind. Wir wollen mit Hilfe von Berechnungen, die uns die Bioinformatik ermöglicht, die Gene ausfindig machen, die das Syndrom auslösen. Zu Beginn haben wir alle Studien der letzten 50 Jahre über Kinder mit partieller Trisomie (das bedeutet, dass sie nur einen Teil der dritten Kopie des Chromosoms haben) untersucht und gesehen, dass einige das Syndrom entwickelt haben und andere nicht. Diejenigen, die das Syndrom entwickelt haben, hatten alle das gleiche Fragment des Chromosoms. Mit dieser einfachen logischen Schlussfolgerung kann man innerhalb des Chromosoms die „kritische“ Region, also die „Schuldigen“ einkreisen. In den beiden folgenden Jahren haben wir die Fälle von 125 Kindern untersucht. Durch die Kombination ihrer Daten ist eine Karte entstanden, die zeigt, dass es nur einen ganz kleinen Bereich gibt, den alle Kinder mit Down-Syndrom gemeinsam haben, der aber bei Kindern ohne Down-Syndrom nie vorhanden ist. Das war das erste Ergebnis, das einen objektiven Fortschritt gebracht hat. Es wurde 2016 in der Zeitschrift Human Molecular Genetics veröffentlicht.
Und was haben Sie innerhalb dieses kritischen Bereichs gefunden?
Das bereitet uns auch großes Kopfzerbrechen. Denn auf diesem Segment, das kleiner als ein Tausendstel des Chromosoms ist, gibt es keine bekannten Gene. Unsere Forschung konzentriert sich darauf herauszufinden, was sich auf diesem Abschnitt befindet, das das Syndrom auslösen könnte. Dazu verwenden wir CRISPR, eine neue Methode, die es uns erlaubt, das Genom sehr schnell zu modifizieren. Dadurch können wir sehen, was mit Trisomie-Zellen passiert, wenn wir das Segment, welches alle Kinder mit Down-Syndrom gemeinsam haben, entfernen.
Lejeune sagte auch: „Ich kann euch nicht in dem Glauben lassen, dass wir in einer bestimmten Zeit eine Therapie finden werden. Niemand weiß, wie lange der Weg sein wird. Wir wissen nur, dass die Kinder da sind, und wenn es noch 20 Jahre dauert, dann sollte man unbedingt sofort anfangen. Ich beziehe meine Gewissheit aus der positiven Hypothese: Wenn es eine Lösung gibt und wenn ich danach suche, werde ich sie auch finden.
Und der zweite Forschungsansatz?
Das ist der metabolische. Wir nehmen Blut- und Urinproben von unseren Patienten und messen die größtmögliche Anzahl an Werten, um Unterschiede zu identifizieren. Das dient dazu, die Intuition von Lejeune zu überprüfen, nach der das Syndrom durch das Anfallen toxischer Umbauprodukte entsteht, welche die Neuronen schädigen. Heute wissen wir dank dieser Messungen, welches die Werte mit den größten Abweichungen bei unseren Patienten sind und welche dafür in Frage kommen, das Syndrom auszulösen. Die Ergebnisse dieser Forschung befinden sich gerade im Revisionsprozess für die Publikation in einer internationalen Fachzeitschrift.
Wie gehen die Daten zusammen, die Sie bei den beiden Ansätzen erhoben haben? Und was bedeutet das?
Wenn wir es schaffen, die Ergebnisse zusammenzubringen, indem wir verstehen, was sich auf diesem Chromosom befindet, das den Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht bringt, und welche Substanzen sich durch diesen veränderten Stoffwechsel bilden, dann könnte man über eine Therapie nachdenken. Wenn man die kritische Substanz eliminiert oder substituiert, könnte das gesamte System in einen Normalzustand zurückkehren. Lejeune hatte alles in einer großen Zeichnung zusammengefasst: eine riesige Maschine, in der jedes Getriebe eine Substanz und jeder Riemen ein Enzym darstellt, das eine Substanz in eine andere überführt. Wenn eines der Getriebe sich nicht mehr so dreht, wie es sollte, entweder zu schnell oder zu langsam, kann die Maschine nicht mehr richtig arbeiten. Wir haben bis jetzt den Ort gefunden, an dem sich wahrscheinlich alles blockiert. Wir wissen aber noch nicht, worin genau das Problem besteht.
Heißt das, dass die Intelligenzminderung zurückgehen könnte …
Alles deutet darauf hin. Aber die Ergebnisse der Grundlagenforschung sind noch keine „Produkte“, wie man heute sagt. Doch das Heilmittel könnte jeder finden, schon bald oder erst in 10 Jahren. In der reinen Forschung ist es immer ein Ereignis, wenn man etwas entdeckt.
Lejeune meinte einen Schritt vor der Lösung zu stehen, als er sagte: „Es ist eine intellektuell weniger schwierigere Aufgabe, als einen Menschen auf den Mond zu schießen.“ Warum sind Sie sich so sicher?
Lejeune sagte auch: „Ich kann euch nicht in dem Glauben lassen, dass wir in einer bestimmten Zeit eine Therapie finden werden. Niemand weiß, wie lange der Weg sein wird. Wir wissen nur, dass die Kinder da sind, und wenn es noch 20 Jahre dauert, dann sollte man unbedingt sofort anfangen. Ich beziehe meine Gewissheit aus der positiven Hypothese: Wenn es eine Lösung gibt und wenn ich danach suche, werde ich sie auch finden.
Und wie verändert das die Art, wie Sie forschen?
Diese Hypothese hat mich dazu ermutigt, das Feld der Forschung möglichst breit abzustecken und „offene“ Methoden zu verwenden, also möglichst frei von Vorurteilen. Das erlaubt es mir, so genau wie möglich auf die Realität zu schauen, die ich studiere. Mit der Bioinformatik können wir zum Beispiel Millionen von Daten analysieren, ohne irgendeinen Aspekt außen vor zu lassen. Eine enger umschriebene Methode, bei der ich von stärker festgelegten Ideen ausgehe, lässt mich nur durch ein Fenster schauen, für das ich mich entschieden habe. Das schließt aber die Möglichkeit von unerwarteten Beobachtungen aus.
Wer finanziert Ihre Forschung?
De facto sind es Spenden. Insbesondere eine private Stiftung aus Mailand, einige betroffene Eltern, ein Leuchtenhersteller und viele Menschen, die von unserer Arbeit hören. In Dozza, in der Nähe von Imola, gibt es ein ganzes Dorf, das jedes Jahr zwei Benefizessen organisiert. Die Händler stellen die Lebensmittel zur Verfügung, Jugendliche servieren an den Tischen und die unvergleichlichen Hausfrauen aus der Romagna machen von Hand die Pasta für mehr als 200 Gäste. Es gibt viele Initiativen wie diese, die es uns erlauben, unsere Forschung fortzusetzen. Deshalb nennen wir in den Danksagungen unserer Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften immer diese Leute, während andere Firmen oder die Fonds der EU nennen. Die Benefizveranstaltungen sind auch Gelegenheiten, bei denen Familien, die Kinder mit Trisomie haben, uns und andere Betroffene kennenlernen. Es ist auch schon vorgekommen, dass Frauen, die ein Kind mit Down-Syndrom erwarteten, durch die Begegnung mit solchen Familien den Mut gefunden haben, sich dieser Prüfung zu stellen.
Was bedeutet es, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben?
Einmal hat mir eine Mutter gesagt: „Wenn ich an all die Tränen der ersten Monate denke … Heute könnte ich niemals mehr auf ihn verzichten. Er hat unsere Familie zusammengeschweißt. Wir gehen viel liebevoller miteinander um. Er hat uns entdecken lassen, was das Wesentliche im Leben ist.“ Bei Menschen mit Down-Syndrom gibt es einen kompensatorischen Effekt: Sie schaffen in ihrem Umfeld ein sehr intensives, emotionales Klima. Man sagt ja auch, sie seien gütiger, liebevoller. Aber in Wirklichkeit ist es etwas Subtileres. Es gelingt ihnen, bei jedem Menschen das Gute hervorzulocken, weil sie fähig sind, um Liebe zu betteln. Das kann allerdings auch zu einem großen Trugschluss führen …
Welchem?
Da ich das Kind liebe, liebe ich auch seine Krankheit. Ich meine, das ist eine gefährliche Haltung, genau wie die gegenteilige: Weil ich die Krankheit hasse, beseitige ich das Kind. Trotz ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, glücklich zu sein, gibt es einen Moment in der Entwicklung dieser Kinder, an dem sie sich bewusst werden, dass sie langsamer sind, geringere Fähigkeiten haben. Und das kann zu großem Leid führen. Eine Mutter hat mir von einer Diskussion mit ihrer Tochter über den Führerschein erzählt. Das Mädchen wollte mit 18 Jahren Auto fahren lernen. Nach tausend Erklärungsversuchen hat die Mutter entnervt gesagt: „Du weißt doch genau, warum du nicht fahren kannst: weil du ein Chromosom zu viel hast.“ Und das Mädchen hat geantwortet: „Ja und? Kann man das nicht rausnehmen?“ Diese Menschen erwarten etwas von uns, und wir haben die Pflicht, sie zu heilen, sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie all das Vernünftige zum Ausdruck bringen können, was in ihnen vorhanden ist.
Was hat „viel Beobachten“ für Sie bedeutet, als Sie mit 47 Jahren eine vielversprechende Karriere aufgegeben und sich für etwas völlig Neues engagiert haben?
Ich habe eine sesshafte Natur, die wenig zu Veränderungen neigt. Seit 35 Jahren sperre ich das Fahrrad immer an denselben Pfeiler in der Via Belmeloro 8, an der Uni. Ich mag weder Reisen noch Kongresse. Seit ich mich dieser neuen Forschung zugewandt habe, musste ich alle möglichen Widerstände überwinden. Vor allem musste ich die Verantwortung für ein solches Projekt übernehmen. Aber die Fakten haben sich mit solcher Macht aufgedrängt, dass ich gar nicht anders konnte, als mich ihnen zu beugen. Die Begeisterung für die Forschung und Lejeunes Menschlichkeit, dass ich die Kinder mit Down-Syndrom kennenlernen durfte, die Unterstützung der Kollegen, dass die Finanzierung zwar mit Mühe, aber doch immer noch rechtzeitig zustande kam. Und vor allem die Freude festzustellen, dass ich mehr ich selbst war, wenn ich mich all dem widmete. Mein Ja erwächst aus all diesen absolut unvorhergesehenen Ereignissen. Das sind die Momente, in denen das, was Gott tut, viel wichtiger ist als jeder andere Gedanke.