
Ijob klagt Gott an: Warum unschuldiges Leid?
Borges bezeichnet es als „erhaben“. Claudel fragt: „Wer hat jemals das Anliegen des Menschen mit solcher Kraft verfochten?“ Warum das Buch Ijob die moderne Vernunft herausfordert.„Ich glaube, wenn es ein Buch auf der Welt gibt, das das Wort ‚erhaben‘ verdient, dann ist es das Buch Ijob.“ Das sagte Jorge Luis Borges bei einem Vortrag 1965 im Instituto Cultural Argentino-Israelí.(1) Das gleiche Adjektiv verwendet Paul Claudel, der in seiner Monografie über Das Buch Job erklärt, unter den Büchern des Alten Testaments sei dieses Buch „das erhabenste, ergreifendste, kühnste und zugleich das rätselhafteste, enttäuschendste und, fast möchte ich sagen, das abstoßendste“. Um seine Adjektive zu rechtfertigen, fügt Claudel hinzu: „Wer hat jemals das Anliegen des Menschen mit solcher Kühnheit und mit solcher Kraft verfochten? Wem hat sich jemals aus der Tiefe seines Glaubens ein solcher Schrei entrungen, ein solches Aufbegehren, eine solche Lästerung?“(2) Das Anliegen des Mannes aus dem Lande Uz, das das Anliegen der ganzen Menschheit ist, wird in diesem Buch zu einem markerschütternden Schrei, der direkt an Gott gerichtet ist: Warum lässt du unschuldiges Leid zu?
Seitdem dieses Werk in den jüdischen und damit auch in den christlichen Kanon eingegangen ist, hat es eine Vielzahl von Autoren inspiriert und ist zum vielleicht am häufigsten „neu geschriebenen“ Buch des Alten Testaments geworden. Vor allem seit Leibniz in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Theodizee begründet hat, ein Teilgebiet der Philosophie, das sich mit der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Bösen beschäftigt: Wenn Gott einer, gut und allmächtig ist, warum existiert dann das Böse? Lässt Gott, der allmächtig ist, das Böse zu? Dann müssten wir daran zweifeln, dass er gut ist. Oder will er das Böse verhindern und kann es nicht? Dann stellen wir seine Allmacht infrage. 
Ein Text, der das Drama des Bösen und vor allem des Leidens Unschuldiger besonders gut darstellt, findet sich in dem Werk Die Brüder Karamasow von Fjodor Dostojewskij. Iwan, der nicht an Gott glaubt, will seinen Bruder Aljoscha davon abhalten, dem Starez Sossima zu folgen. Daher spricht er über den stärksten Einwand gegen die Existenz Gottes: das Leiden Unschuldiger. Das Leid, das Erwachsene erleiden, wäre bereits ein gewichtiger Einwand. Aber „sie haben von dem Apfel gegessen, erkennen seitdem, was gut und was böse ist […]. Und noch heute fahren sie fort, von dem Apfel zu essen“(3), das heißt, sie sind mitverantwortlich für die Unordnung in der Welt. Doch das Leiden der Kinder sei unentschuldbar, erklärt Iwan.
Dostojewskij erspart uns nicht die Schilderung einiger Grausamkeiten, die an Kindern begangenen wurden, damit der Einwand gegen die Gerechtigkeit oder gar Existenz Gottes nicht abstrakt bleibt. Über mehrere Seiten, die für den Leser nur schwer zu ertragen sind, beschreibt Iwan die Brutalität, mit der die Türken die Aufstände in ihrem Land niederschlagen. Vor den Augen der Mütter werfen sie Neugeborene in die Luft und spießen sie mit ihren Bajonetten auf. Sie bringen ein Kind auf dem Arm seiner Mutter zum Lachen, halten ihm die Pistole hin, damit es danach greift, und schießen ihm dann den Kopf weg. Und all das nur zum Vergnügen.
Oder will Gott das Böse verhindern und kann es nicht? Dann stellen wir seine Allmacht infrage.
Die lange Reihe von Ungerechtigkeiten endet mit einer Erzählung über einen russischen General und reichen Grundbesitzer. Eines Tages warf der Sohn einer seiner Dienerinnen im Spiel einen Stein und verletzte damit einen seiner Jagdhunde am Bein. Nachdem der Schuldige gefunden worden war, organisierte der General am folgenden Tag eine Treibjagd und befahl, den Jungen vor dem gesamten Dienstpersonal auszuziehen und ihn dazu zu zwingen, wegzurennen. Dann hetzte er die Hundemeute auf ihn, die ihn vor den Augen der Mutter zerfleischte.
Iwan übernimmt hier die Rolle des Ijob (das biblische Buch gehört explizit zu den Lieblingslektüren des Starez Sossima) und weigert sich, „Vergeltungstheorien“ zu akzeptieren, die einen Zusammenhang zwischen Sünde und Strafe herstellen. Bei Kindern funktionieren sie nicht. Nicht einmal die raffinierteren, die im Leid Unschuldiger einen Beitrag zur ewigen Harmonie am Ende der Zeiten sehen. „Ich brauche Vergeltung […]. Und zwar eine Vergeltung nicht in der Unendlichkeit, irgendwo und irgendwann, sondern hier, schon auf Erden und vor meinen eigenen Augen. […] Ich habe etwa gelitten, um mit meiner eigenen Person, mit meinen Missetaten und meinen Leiden Dung für die künftige Harmonie von anderen zu sein?“(4)
Dostojewskij hätte sich nicht vorstellen können, dass das 20. Jahrhundert die in seinem Roman beschriebenen Grausamkeiten gegen Unschuldige noch weit übertreffen würde. Die Konzentrationslager der Nazis oder die stalinistischen Säuberungsaktionen machen uns sprachlos. Ein Hieb in den Magen der klassischen Apologetik, so dass die Frage, ob und wie man nach Auschwitz noch Theologie betreiben könne, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zu einem Gemeinplatz wurde.
Man versteht also, warum Ijob in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts eine so große Rolle spielt und gewissermaßen zum Sprachrohr der Menschheit geworden ist, die zu Gott schreit und ihn zu dieser Ungerechtigkeit befragt. So stellt ihn Kierkegaard ausdrücklich in seinem Werk Die Wiederholung dar: „Sprich darum Du, unvergesslicher Hiob! Wiederhole alles, was Du gesagt hast, Du gewaltiger Fürsprecher, der unerschrocken wie ein brüllender Löwe vor den Gerichtsstuhl des Höchsten tritt! […] Deiner bedarf ich, eines Mannes, der laut zu klagen versteht, dass es im Himmel widerhallt“.(5)
Auch der spanische Dichter José Jiménez Lozano, Gewinner des Cervantes-Preises, lässt Ijob in seinem Gedicht Abrechnung auftreten, um sich bei Gott über die ungerechte Welt zu beklagen:
„Wir leben einfach. Weißt du vielleicht
wie mühsam es ist, die Tage zu ertragen?
Hast du dich vielleicht gezeigt,
außer in einem brennenden Dornbusch?
Und in Auschwitz, wo warst du da?
Eifersüchtig auf unsere spärlichen Freuden, belauerst du uns;
bist abwesend in der Trauer,
grausam wie Eisstiefel
oder die unerbittliche Augustsonne.
Bist du es nicht, der die Weltmaschine steuert?
Doch die Spatzen sterben im Morgenfrost,
und die Kinder vor Hunger,
während die Mächtigen in deinem Namen gesalbt werden,
und du schweigst.
‚Der Herr ist nicht da‘, sagen deine Engel,
‚er nimmt weder Anrufe entgegen, noch ruft er zurück.‘“(6)
Man muss bedenken, dass der Mensch, der den Allerhöchsten hier anklagt, der „westliche“ Mensch ist, dessen Vernunft Ungerechtigkeit nicht erträgt. Und der Gott, an den sich dieser Mensch wendet, ist ebenfalls ein „westlicher“ Gott, der jüdisch-christliche Gott, der behauptet, seine ganze Schöpfung sei gut, der die Gerechtigkeit verteidigt und den Menschen liebt, den er nach seinem Abbild und ihm ähnlich erschaffen hat. Dann kann man das Paradox verstehen, das C.S. Lewis in seiner Schrift Über den Schmerz genial beschreibt: „Das Problem des Schmerzes [wird] durch das Christentum eher geschaffen als gelöst; denn der Schmerz wäre kein Problem, hätten wir nicht, vergraben in unsere tagtägliche Erfahrung mit dieser schmerzerfüllten Welt, dennoch die, wie wir glauben, gültige Versicherung empfangen, die letzte Wirklichkeit sei voller Gerechtigkeit und Liebe“.(7) Das ist so wahr, dass wir in dem mesopotamischen Kontext des Buches Ijob bereits die Aporien erkennen können, in die die Vergeltungstheorie führt, welche das Leiden als göttliche Strafe versteht. Wir sehen allerdings noch keine direkte Konfrontation mit dem „verantwortlichen“ Gott, um ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Und angesichts des Schreies des Menschen, der ungerechterweise leidet und vom Himmel dafür eine Erklärung fordert, sind in jeder Epoche auch „Verteidiger“ Gottes aufgetreten, bereit ihm zu Hilfe zu eilen. Gestern wie heute. Die drei Freunde Ijobs meinten es gut, als sie sich zusammentaten, um diesen gebrochenen Mann zu trösten. Aber sie konnten es nicht ertragen, dass er Gott anklagte und ihm Ungerechtigkeit vorwarf. So machten sie sich zu Verteidigern Gottes, wenn sie auch letztlich nur das Bild von Gott bewahren wollten, das sie im Kopf hatten. Dieses entsprach einem Ursache-Wirkungs-Schema, in dem es keinen Platz für Fragen gibt, für das „Warum?“, und noch viel weniger für eine Antwort Gottes. „So kann ein Mensch zum Beispiel Gott recht geben wollen“, sagt Kierkegaard, „obgleich er selber recht zu haben glaubt.“(8)
„Du leidest? Dann wirst du wohl Böses getan haben. Wenn nicht du, dann deine Kinder“, so argumentieren sie (vgl. Ijob 4,7-8;8,4-6). Nach Ansicht der Freunde Ijobs bewegt sich Gott „innerhalb der Grenzen der Vernunft“. Diese kann und darf er nicht überschreiten. Wenn er sie überschritte, wäre er nicht mehr vorhersehbar. Dann wären wir seiner Willkür ausgeliefert. Dann müssten wir ihm Fragen stellen, deren Antwort wir nicht kennen: „Warum Schmerz? Warum Ungerechtigkeit?“ Wenn Ijob unschuldig wäre, hieße das, einen gefährlichen Spalt in einem geschlossenen Universum zu öffnen: „Darum drängt mich meine Erregung zur Antwort und deswegen stürmt es in mir. Schmähende Rüge muss ich hören“, erwidert Zofar dem Ijob (Ijob 20,2-3).
Die Position von Elifas, Bildad und Zofar kann man, wie jede andere schwache und vorgefasste Meinung, nur aufrechterhalten, indem man die Wirklichkeit, die einem begegnet, zensiert. Ijob erklärt seine Unschuld. Sein tugendhaftes Verhalten ist außerdem allgemein bekannt. Aber es gibt keinen Platz für Tatsachen, die nicht in unser Schema passen. Die Wirklichkeit, die nicht unserem Maß entspricht, muss uminterpretiert werden. Und Elifas, der seine Ursache-Wirkung-Logik auf Ijob anwendet, beschreibt ihm sogar die Sünden, die den Zorn Gottes hervorgerufen haben sollen (vgl. Ijob 22,6-9). Er erfindet sie, wie jemand, der für eine offensichtliche Wirkung eine erklärende Hypothese sucht! Borges hat sehr gut erfasst, worum es in dem Kampf zwischen der Position Ijobs und der seiner Freunde ging, als er die Absicht des biblischen Buchs so zusammenfasste: „Wir können keine menschlichen Adjektive auf Gott anwenden; wir können ihn nicht mit unseren Maßen messen.“(9)
Daher darf uns der Vergleich nicht überraschen, den María Zambrano zwischen den Freunden Ijobs und dem Rationalismus zieht, der so kennzeichnend ist für unsere Zeit: „Währenddessen die ratgebenden Freunde erhobenen Hauptes, selbstsicher und sicher, den gerechten Platz innezuhaben – den des Gerechten, der niemals zu Boden geworfen werden kann –, Gründe der Vernunft anführen. Und ihre Gründe tauchen wieder im Laufe der Geschichte der triumphierenden Vernunft auf, der Vernunft des Aufrechten, der das Arbeiten und Leiden seines Innern zu Kapital gemacht hat; dem Innern gegenüber sind sie taub, mit der Taubheit desjenigen, der die Klarheit, die dem Blut entströmt, in Stein umwandelt und die Räume der Innerlichkeit mit Mauern umgibt, damit der Logos nicht in sie herabsteige. Propheten oder zumindest Vorläufer einer Vernunft, die sich entinnerlicht und damit unentwirrbar wird.“(10)
Wer hat Recht in dieser Auseinandersetzung, die sich über 35 Kapitel hinzieht (Ijob 3-37)? Es ist offensichtlich, dass unsere moderne Sensibilität zu Ijob neigt. Aber was sagt das Buch selbst? Die Aussage Gottes im letzten Kapitel, als er sich an Elifas wendet – „Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Ijob“ (Ijob 42,7) –, enthält ein für den mesopotamischen Kontext dieses Werkes revolutionäres Urteil. Wie ist es möglich, dass Gott sich gegen jene wendet, die vorgeben, ihn zu verteidigen? Mit einem Schlag zerstört Gott die Vergeltungstheorie, die das Leiden der Menschen mit den von ihm begangenen Fehlern in Verbindung bringt. Mit diesem Urteil befreit er die Vernunft von einer jahrhundertealten Fessel und gibt ihr ihren natürlichen Raum zurück, den des Warum, der Suche nach einem Sinn. 
Wir, Kinder dieser revolutionären Sichtweise, schauen mit Sympathie auf Ijob, der mit Gott auf Augenhöhe spricht und Erklärungen von ihm verlangt. In Wirklichkeit geht er sogar noch weiter. Er will Gott vor ein Gericht zitieren – für das er aber natürlich keinen Richter findet (vgl. Ijob 9,14-35;13,1-23). Und dennoch bereitet er seine Verteidigung vor, bringt seine Anschuldigungen vor (vgl. Ijob 23,1-9; 29,1-31,40). Es ist immer wieder überraschend, dass die Bibel Seiten wie diese enthält, in denen das Geschöpf seinen Schöpfer anklagt. Es scheint paradox, wenn wir dagegen die ersten Seiten der Heiligen Schrift lesen, wo davon berichtet wird, wie Gott durch sein Wort den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis schafft und feststellt, dass sein Werk „sehr gut“ ist (Gen 1,31). Oder die folgenden, wo der Schöpfer den ersten Menschen aus „Staub vom Erdboden“ formt (vgl. Gen 2,7).
Der Rebell Ijob repräsentiert für uns die ganze Würde der menschlichen Vernunft, die keine Ungerechtigkeit erträgt, keine unzureichende Erklärung, kein Leiden, das unserem ursprünglichen Gefühl, dass alles gut ist, zuwiderläuft. Und die ganze Verteidigung Ijobs baut auf einem Paradox auf. Der Mensch ist beinahe ein Nichts im Gesamt der Schöpfung. Wenn wir die Unermesslichkeit des Universums betrachten, was ist dann dieses Wesen, das erst spät an einem unbedeutenden Ort in der unglaublichen Zahl von Galaxien geboren wurde? Und trotzdem ist dieses Wesen das Selbstbewusstsein des ganzen Universums. In ihm, in seiner Vernunft, kommt die Natur zum Bewusstsein ihrer selbst, gelangt sie zur Erkenntnis und wird sich ihres Bedürfnisses nach Sinn und Gerechtigkeit bewusst. So weit, dass sie aufbegehrt und von ihrem Schöpfer Rechenschaft verlangt.
„Bekam Hiob denn unrecht?“, fragt Kierkegaard. „Ja! für ewig; denn höher kann er nicht kommen als bis zu dem Gerichtshof, der ihn gerichtet hat. Bekam Hiob recht? Ja! für ewig, dadurch, dass er vor Gott unrecht bekam.“(11) Der fundamentale Unterschied zwischen Ijob und seinen Freunden liegt darin, dass er Gott als eine lebendige Person begreift (das Sein, dem sich alles Seiende verdankt). Er trägt mit ihm einen Kampf aus, von welchem er sich Antworten auf eine quälende Frage erwartet. Die drei Freunde Ijobs dagegen verkürzen Gott auf eine Formel, die jegliche Frage im Keim erstickt.
Der Rebell Ijob repräsentiert für uns die ganze Würde der menschlichen Vernunft, die keine Ungerechtigkeit erträgt,
Abermals ist es die andalusische Schriftstellerin María Zambrano, die eine Übereinstimmung mit unserer westlichen Welt feststellt. Ijob, so meint sie, entwickelt seine Gründe, indem er sie Gott anklagend entgegenschleudert, „dieselben Gründe, die das Denken der Philosophie ohne jegliches Klagen hervorbringt, denn ihr fehlt das Gegenüber. Der Gott der Philosophie ist nicht jemand, sondern etwas – was nicht weniger ein Wunder, ein menschliches Wunder ist –, aber es ist nicht der Gott, der Herr, Freund und Gegner, der sich zurückzieht. Als Denkender – im Sinne der abendländischen Überlieferung – verfügt der Mensch nicht über einen Gott, den er anrufen kann, einen Gott seiner Innerlichkeit. Die Innerlichkeit wurde von Anfang an durch das Philosophieren unterdrückt, zum Schweigen gebracht“.(12)
Das Buch Ijob hält noch weitere Überraschungen bereit. Vor allem soll Gott auf die Frage bezüglich der Ungerechtigkeit und des Leids antworten, und seine Antwort lässt tatsächlich auf sich warten. Sie kommt erst am Ende und nimmt die letzten vier Kapitel des Werkes ein (Ijob 38-41), vor dem Epilog. Wenn das göttliche Urteil über die Freunde Ijobs verwundert, so ist die lang erwartete Rede Gottes vor einem Publikum, das ganz Ohr ist, nicht weniger überraschend. Man könnte vielleicht mit einer Eröffnung rechnen in der Art: „Und Gott traf den Ijob mit einem Blitz aus dem Wettersturm.“ Das wäre die Antwort, die viele von Gott erwarten würden, besonders solche, die in der Bibel nichts anderes sehen als einen weiteren Ausdruck religiöser Literatur Mesopotamiens. Doch dann bräuchte man nicht einen solchen Artikel zu schreiben, und die Philosophie und Theodizee im Westen wären auch nicht das, was sie sind. 
Gott nimmt die Herausforderung Ijobs an. Er nimmt den Fehdehandschuh auf. Kampfesbereit fordert er ihn dazu auf, sich die Lenden zu gürten (vgl. Ijob 38,3). Er begibt sich auf das Niveau seiner Kreatur herab, er begibt sich auf deren Höhe, um mit ihr zu ringen. Ijob hat ihn verklagt, er soll vor Gericht erscheinen. Gott setzt sich allerdings nicht auf die Anklagebank, sondern vielmehr auf die Schulbank: „Ich will dich fragen, du belehre mich!“ (Ijob 38,3) Er fordert Ijob, der sich im Eifer seiner Verteidigung auf Augenhöhe mit Gott erhoben hat, dazu auf, sich ans Katheder zu stellen und auf die Fragen des Allmächtigen zu antworten, der sich für einige Minuten in den Schüler des „weisen“ Fragestellers verwandelt.
Mit tiefer Ironie beginnt er nun eine Reihe von Fragen zu stellen, die keine Antwort erwarten, und das über mehr als vier Kapitel. Vor einem Ijob, der zwischendurch ganz klein wird, zählt Gott alle Wunder und Geheimnisse der Schöpfung auf und fragt den Mann aus Uz nach deren Ursprung, den er ja zweifellos kennen muss, wenn er die göttliche Logik angreifen will:
„Wo warst du, als ich die Erde gegründet?
Sag es denn, wenn du Bescheid weißt.
Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja.
Wer hat die Messschnur über sie gespannt?
Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt?
Oder wer hat ihren Eckstein gelegt,
als alle Morgensterne jauchzten,
als jubelten alle Gottessöhne?“
(Ijob 38,4-7)
Nachdem diese Befragung – die sich bis zum Ende des 41. Kapitels hinzieht – abgeschlossen ist, endet die Rede Gottes. Was hat er also auf die Frage nach der Ungerechtigkeit und dem Leid Unschuldiger geantwortet? Die Tatsache, dass das Buch Ijob in der Vorstellung der Leute als Paradigma für die Frage nach dem ungerechten Leid steht, mutet merkwürdig an. Wenn wir sie fragen würden, wie Gott auf die Klage des Ijob antwortet, wäre die Reaktion verlegenes Schweigen. Manch einer würde vielleicht sogar fragen: „Antwortet Gott überhaupt in diesem Buch?“ Und das ist kein Fall von Ignoranz. Selbst Spezialisten verstehen die „Antwort“ Gottes nicht. Was hat es für einen Sinn, mit einer minutiösen Beschreibung der Wunder der Natur auf Fragen zu antworten, die mit der Freiheit auf moralischer Ebene zu tun haben?
Gott nimmt die Herausforderung Ijobs an. Er nimmt den Fehdehandschuh auf. Ijob hat ihn verklagt, er soll vor Gericht erscheinen. Gott setzt sich allerdings nicht auf die Anklagebank, sondern vielmehr auf die Schulbank:
Eine nicht unerhebliche Zahl von Exegeten meint, dass Gott Ijob keine Antwort gibt, wahrscheinlich weil die Kapitel, die der göttlichen Gegenrede gewidmet sind, ursprünglich nichts mit der Frage und dem Drama des Mannes aus Uz zu tun hatten. In dem langen und komplexen Prozess der Redaktion des Werkes seien diese Kapitel an ihrem gegenwärtigen Platz „gelandet“, stammten aber von einem anderen Ort. „Die in den Wolken erscheinende Gottheit bringt der gequälten Seele keine Antwort und das objektiv gehaltene schöne Naturgedicht kann ein verwundetes Herz nicht heilen“ (P. Volz).(13) „Wenn sich diese Kapitel nicht da befänden, wo sie sind, käme tatsächlich niemand auf die Idee, sie dort hinzustellen.“ (M. Jastrow)(14) Ich sehe „nichts […], was die Freunde nicht längst gesagt haben. […] Drei Stunden Naturkunde für Hiob“ (L. Steiger).(15) „Jahwe antwortet auf moralische Fragen mit physikalischen“ (E. Bloch).(16) 
Die Antwort Gottes wurde schließlich sogar als „irrelevant“ abqualifiziert: „Es scheint etwas wirklich Irrelevantes zu sein. Es ist, als wedele man mit einer Rassel vor einem weinenden Kind, um es von seinem Hunger abzulenken.“ (R.A.F. MacKenzie)(17) Einige Exegeten gehen jedoch von der Tatsache aus, dass die Gegenrede Gottes bei Ijob Wirkung zeigt. Gerhard von Rad sammelt die (einigermaßen ratlose) Reaktion seiner Kollegen und schließt wie folgt: „Ob auch der antike Mensch so reagiert hat, ist nicht so sicher. […] Auch Hiob hat ja selbst die große Anrede schneller und unmittelbarer verstanden, als es dem modernen Leser gelingen will“.(18) Mit anderen Worten: Hindert uns vielleicht unsere moderne Mentalität, die Antwort zu verstehen, die Gott Ijob gibt? Waren diejenigen, die dieses Werk vor mehr als zweitausend (oder vor tausend) Jahren lasen, genauso ratlos wie wir? Was wir akzeptieren müssen, wenn wir den Gesprächsfaden des Buches respektieren wollen, ist, dass Ijob sich von Gott gemaßregelt fühlte: „Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche.“ (Ijob 42,5-6)
Da Ijob sich widerlegt fühlte, müssten wir ihn fragen: Inwiefern antwortet die Rede Gottes auf deine Anklage? Wenn wir einen Blick auf das Kino werfen statt auf die Exegese oder die Literatur, dann können wir dort ein fernes Echo jener Antwort finden, die von weither aus dem Land Uz kommt. Der Regisseur Terrence Malick hat einen sehr schönen Film gedreht, The Tree of Life (2011), dessen Drehbuch der Klage Ijobs folgt. Vom ersten Bild an, das einen Satz aus dem Buch Ijob zitiert („Wo warst du, als ich die Erde gegründet? ... als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne?“, Ijob 38,4.7), bis zu dem Drama einer Familie, die ein Kind verliert, ist der ganze Film durchdrungen von der Frage nach dem Geheimnis des Leidens, der Ungerechtigkeit, des Todes. Aber das Überraschende ist, welche Aufmerksamkeit Malick in seinem Film der Gegenrede Gottes im Buch Ijob schenkt, die vorgibt, auf dieses Geheimnis zu antworten.
Die ersten Minuten des Films zeigen, parallel zum Buch Ijob, das Unglück einer Mutter, die Gott Treue versprochen hat („Ich werde dir treu sein, was auch geschieht“). Sie verliert ihren erst 19-jährigen, zweiten Sohn. Auch sie wird von ihren „Freunden“ (in diesem Fall von ihrer Mutter) getröstet: „Das Leben geht weiter, Menschen kommen und gehen. Nichts bleibt, wie es ist. Du hast immer noch die beiden anderen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen ...“ Das ist der Moment, in dem sich der Schrei der Frau O’Brien zu Gott erhebt: „Meinst du, dass ich dir nicht treu war? Warum? Wo warst du?“ Damit beginnt die Auseinandersetzung. Jetzt ist Gott am Zug.
In dem Film beginnt nun eine Art Rückblende, die die ganze Schöpfung ins Bild setzt und mehr als fünfzehn Minuten dauert. Es ist verständlich, dass manche an diesem Punkt ausgeschaltet haben, oder einige, die zu spät kamen, meinten, sie sähen Werbung für einen anderen Film. Das geniale Drehbuch Malicks erfordert ein Minimum an Vorkenntnissen, damit man versteht, was gemeint ist. Die Antwort Gottes an Ijob, den damaligen wie den heutigen, verlangte nach einer visuellen Umsetzung wie im Kino, um begriffen zu werden.
Während wir noch mit der Mutter leiden, die ihr Kind verloren hat, „zwingt“ Malick uns, dieser großen Geburt beizuwohnen, die die Schöpfung der Welt darstellt. Er erzählt sie nicht, er erklärt sie nicht. Er macht uns gewissermaßen zu Protagonisten. Er zwingt uns, sie zu erleben. Fünfzehn Minuten müssen wir wie angewurzelt auf unseren Stühlen sitzen und zuschauen. Ohne ein einziges Wort. Nur begleitet von dem Lacrimosa aus dem Requiem, das Zbigniew Preisner zum Andenken an seinen Freund, den Regisseur Krzystof Kieslowski komponiert hat. Das gleiche Verfahren, das Gott bei Ijob anwendet: Er lässt alle Geheimnisse der Schöpfung vor seinen Augen vorbeiziehen, ununterbrochen, vier Kapitel lang.
Die Dynamik des Schmerzes hatte dazu geführt, dass Ijob sich in sich selbst verkrümmte. Die Kraft der Vernunft, die nicht aufhört nach Gründen zu suchen, hatte Ijob zu Gott erhoben und ihn taub gemacht für alles, was ihn umgab. Als er vor dem Höchsten stand, öffnete dieser seinen Blick, damit er sich dessen bewusst wurde, was ihn umgab, nämlich der Schöpfung. Was ist so interessant an der Schöpfung? Inwiefern kann ihr Anblick Ijob zum Umdenken bringen? Welche neuen Erkenntnisse vermittelt sie dem Mann aus Uz?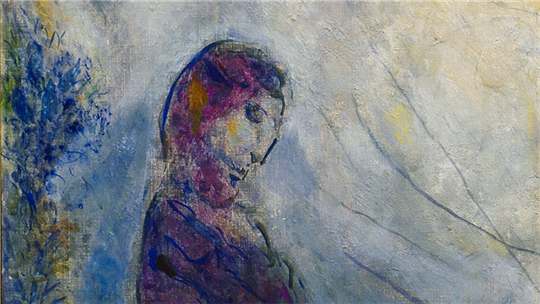
Die Bilder von Malick können uns helfen, das zu verstehen. Sie sind ebenso wirkmächtig wie die Bilder, die durch die Fragen Gottes vor Ijob erschienen sein müssen. Sie beeindrucken, sie bewegen uns und sie versetzen uns in Staunen. Das ist in der Tat die primäre Aufgabe der Wirklichkeit: uns herauszufordern, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was uns vor allem staunen lässt, ist, dass die Dinge da sind, dass sie überhaupt existieren, ohne dass wir es angeordnet hätten. Sie sind nicht einfach nur eine Illustration, die unsere Gedanken begleitet. Hier zeigt sich, wie kurzsichtig die Moderne ist. Damit wird auch deutlich, warum die Gegenrede Gottes im Buch Ijob die Forscher so ratlos macht.
Der Positivismus, von dem unser Blick bestimmt ist, betrachtet die Dinge als ein bloßes positum, etwas, das einfach da ist, unbewegt, und an dem mich höchstens die Transformationen interessieren, die dynamischen Gesetze, die seine Entwicklung steuern. Doch sich die Wirklichkeit zu „erobern“, bedeutet nicht einfach, sie als positum wahrzunehmen. „Man hat die Haltung gegenüber der Wirklichkeit außer acht gelassen, in dieser Epoche der Moderne, die man als jene der Wirklichkeitskrise definieren kann“, sagt Zambrano. „Und die Haltung gegenüber der Wirklichkeit ist etwas anderes als die Bedingungen der Erkenntnis der Wirklichkeit, angefangen bei der schlichten Wahrnehmung.“(19) Da kommt unsere Freiheit ins Spiel, als Haltung gegenüber der Wirklichkeit. Tatsächlich fährt Zambrano fort: „Wenn die Haltung gegenüber der Wirklichkeit ihre Erkenntnis bestimmt und sogar, ob sie einem überhaupt gegenwärtig wird, dann, weil darin – sogar darin – wie in allem die menschliche Freiheit zum Ausdruck kommt, so dass man zu ihr sogar nein oder ja sagen kann. ..... Die Wirklichkeit, die sich in gewissem Sinn selber aufdrängt, überwältigend, unerbittlich, muss angesichts der conditio humana doch gesucht werden.“(20)
Der erste Schritt bei dieser Suche ist unsere Aufmerksamkeit. Zambrano beschreibt ihn als „eine Art Zurücktreten, ein Sich-Zurücknehmen des Subjekts, damit sich die Wirklichkeit offenbaren kann.“(21) Ganz klar ein Akt der Freiheit. Erst dann zeigt sich uns die Wirklichkeit nicht mehr so sehr als positum, sondern als datum, als etwas Gegebenes, das einen Geber impliziert. Sie offenbart sich uns. Das können wir in solch klaren, aufmerksamen Momenten erkennen, wenn die Wirklichkeit uns nicht mehr undurchsichtig erscheint, wenn wir sie nicht als selbstverständlich voraussetzen und nicht meinen, sie sei einfach „standardmäßig da“. Sie gibt sich uns, und das überrascht uns. Nur das, was gegeben ist – oder besser gesagt das, was nicht wir mit unseren Händen herstellen –, kann uns überraschen.
Und Ijob gibt auf. Er lässt sich ergreifen, überwältigen, beherrschen von einer Gegenwart, die alle Dinge trägt. Warum setzen wir modernen Menschen diesem Dialog, den Ijob uns überliefert hat und für den uns das Beeindruckende der Wirklichkeit öffnet, so viel Widerstand entgegen?
Und datum, Gegebenes, hat tatsächlich die gleiche Wurzel wie donum, Geschenk. Jene wunderbare Wirklichkeit ist ein Geschenk, das in uns ein Gefühl der Dankbarkeit hervorruft. Schon als kleine Kinder hat uns unsere Mutter dazu erzogen, für etwas, das uns gegeben wurde, zu danken: „Wie sagt man?“ „Danke.“ Das übt Gott als geduldiger Vater mit Ijob ein. Deswegen lässt er alle Wunder der Schöpfung vor seinen Augen vorbeiziehen, alles, was uns staunen lässt und beeindruckt, alles, was kein bloßes positum ist, sondern ein donum. Und das führt zur Dankbarkeit. Das gleiche macht Malick mit uns. Ijob und der Zuschauer im Kino, also wir, können diese Schwelle nicht überschreiten ohne eine Entscheidung unserer Freiheit.
Und Ijob gibt auf. Er lässt sich ergreifen, überwältigen, beherrschen von einer Gegenwart, die alle Dinge trägt: „Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.“ (Ijob 42,5) Warum setzen wir modernen Menschen diesem Dialog, den Ijob uns überliefert hat und für den uns das Beeindruckende der Wirklichkeit öffnet, so viel Widerstand entgegen? Selbst das Wort „Gott“ ist für uns problematisch. Was nicht irgendwie in unserer grundlegenden menschlichen Erfahrung präsent ist, und sei es auch nur als Möglichkeit, können wir nicht erkennen. Und hier kommt erneut unsere Freiheit ins Spiel. Der französische Hermeneutiker Paul Ricœur bindet die Interpretation der äußeren Zeichen an das Verständnis der eigenen Person. „Wer bin ich?“, ist eine Frage, der wir nicht ausweichen können. Jede Handlung und jede beliebige Interpretation bedingt eine, zumindest implizite, Haltung zu dieser Frage.(22) Damit stimmt Ricœur der These von Jean Nabert zu, der Mensch versuche immer, sich selbst zu begreifen, da ihm unausweichlich die Unverhältnismäßigkeit bewusst würde zwischen dem, was er ist (das empirische oder reale Ich) und dem, was er sein könnte oder müsste (das reine Ich, das der Ort ist, an dem das Absolute in Erscheinung tritt). Nabert definiert dieses Bewusstwerden des Selbst als „ursprüngliche Bejahung“.(23)
Ijob nähert sich der historischen Offenbarung des Göttlichen nicht in „neutraler“ Weise, als abstraktes Ich an, was a priori von allem frei wäre und alles, was es umgibt, leidenschaftslos beurteilte. Das hebräische Original der Antwort Ijobs an Gott lautet wörtlich: „Ich hörte dir mit den Ohren zu, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen“ (vgl. Ijob 42,5). Wenn er sagt: „Ich hörte dir mit den Ohren zu“, bezeugt Ijob damit, dass das Absolute schon auf geheimnisvolle Weise in seinem Bewusstsein gegenwärtig war, dass er die „ursprüngliche Bejahung“ schon vollzogen hatte in der Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Die Vernunft des Mannes aus Uz, der sich erhebt und Gott zum Kampf auffordert, der im Dialog mit ihm nach dem Sinn sucht, erkennt das Absolute von vorneherein an. Gleichzeitig lässt ihn all das Widersprüchliche, das er erlebt, nach einem Zeichen des Absoluten in der Geschichte schreien. Er fordert, er bettelt darum, dass dieser sich zeigen möge: „Wüsste ich doch, wie ich ihn finden könnte, gelangen könnte zu seiner Stätte. Ich wollte vor ihm den Rechtsfall ausbreiten, meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, mit welchen Worten er mir Antwort gibt, möchte erfahren, was er mir zu sagen hat.“ (Ijob 23,3-5)
Nabert erklärt, das reine Ich – das das Absolute in seinem Bewusstsein anerkennt – weise das Bewusstsein an, außerhalb seiner selbst (in der Geschichte, in der Welt) nach Zeugnissen des Göttlichen zu suchen und diese anzuerkennen.(24) Dieses Ich trage die „Kriteriologie des Göttlichen“(25) in sich, so dass es fähig sei, die historische Offenbarung des Göttlichen in kontingenten Zeichen zu erkennen. Ijob sagt es so: „Ich möchte wissen, mit welchen Worten er mir Antwort gibt, möchte erfahren, was er mir zu sagen hat.“ (Ijob 23,5) Die Offenbarung Gottes in der Schöpfung drängt sich Ijob nicht gewaltsam auf. Sie begegnet in ihm auf unvorhergesehene und nicht ableitbare Weise dem, was Nabert als die „die Sehnsucht nach Gott“ bezeichnet, die mit der ursprünglichen Bejahung oder der Wahrnehmung seiner selbst übereinstimmt.(26) „Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.“ (Ijob 42,5) Dieses „Hörensagen“, die ursprüngliche Erfahrung, verwandelt sich in ein Urteil über die geschichtliche Offenbarung Gottes („Mein Auge hat dich geschaut“). Die göttliche Offenbarung selbst weitet wiederum die Vernunft Ijobs, sie weckt die ihm angeborene „Kriteriologie des Göttlichen“, damit er in der Schöpfung das erste kontingente Zeichen des Absoluten anerkennt. Und er widerruft und bereut.
Doch was ist mit dem Leid? Und der Ungerechtigkeit, die er erlitten hat? Und dem Kind, das von den Hunden zerfleischt wird in dem Roman von Dostojewskij? Die Frage ist nicht verstummt, die Wunde ist noch offen. Jetzt aber verwandelt sie sich in das Weinen eines Kindes bei seiner Mutter. In der Tat steigt Ijob jetzt von dem unbequemen Katheder herunter und nimmt auf der Schulbank Platz. Jetzt ist er es, der seine Fragen an Gott richtet: „Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich!“ (Ijob 42,4) Und damit endet das Buch. Wir können uns Ijobs Fragen vorstellen, aber nicht die Antworten, die Gott ihm gibt. In diesem Sinne ist dies ein Buch mit offenem Ende, wie das ganze Alte Testament ein Buch mit offenem Ende ist, das nach Vollendung verlangt.
Unsere westliche Tradition, die auf dem Neuen Testament aufbaut, stellt weiter Fragen. Sie erhebt ihre Stimme gegen das Böse und die Ungerechtigkeit. Aber sie kann es nicht mehr tun unter Absehung von jenem einzigartigen, gellenden Schrei eines neuen Ijob am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Zwischen dem Buch Ijob und unseren Tagen steht die überraschende Botschaft des Christentums: Gott ist Mensch geworden, er ist in die Geschichte eingetreten. Jesus von Nazareth hat keine theoretische „Lösung“ für das Problem des Leids gebracht. Er hat es selbst auf sich genommen, indem er am Kreuz starb. Die moderne Theodizee muss sich diesem Paradox stellen, das uns aus der Geschichte überkommen ist: Ein Ereignis in Raum und Zeit (Leiden, Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth), und nicht eine Überlegung, wird zum Schlüssel für das Verständnis der Frage nach dem Leid und dem Bösen.
Gott ist Mensch geworden, er ist in die Geschichte eingetreten. Jesus von Nazareth hat keine theoretische „Lösung“ für das Problem des Leids gebracht. Er hat es selbst auf sich genommen, indem er am Kreuz starb.
Aber ist das möglich? Kann das Absolute sich in der Geschichte, in kontingenten Dingen zeigen? Unsere moderne Vernunft leistet erneut beinahe instinktiv Widerstand gegen diese Hypothese. Zwei Väter des modernen Denkens, Immanuel Kant und Gotthold Ephraim Lessing, haben diesem Befremden Ausdruck verliehen.(27) Wir haben bereits gesehen, wie der Akt der Freiheit, den die ursprüngliche Bejahung erfordert, uns offen macht für das Sich-Bezeugen des Absoluten in unserem Bewusstsein. Von hier aus erscheint die Möglichkeit, dass dieses Absolute sich in der Geschichte in kontingenten Zeichen offenbart, als eine Hypothese, der sich die Vernunft nicht verschließen darf.(28) Damit betreten wir das Feld der Verifizierung in der Geschichte (geleitet von der „Kriteriologie des Göttlichen“, die wir in uns vorfinden). Gestützt auf die Philosophie Naberts verteidigt Ricœur die Möglichkeit, dass das Absolute sich in der Geschichte offenbart, und macht sie zur Grundlage der Überwindung des Bösen. Das Böse kann nämlich nach Ricœur nur durch „absolute Handlungen“ ausgerottet werden(29), beziehungsweise durch kontingente Fakten, in denen ein freies Bewusstsein seine Befreiung anerkennt, oder, um es mit Nabert zu sagen, in denen „das, was dem Anschein und dem menschlichen Urteil nach nicht zu rechtfertigen ist, nicht das letzte Wort im Leben hat“(30). Aber können diese „absoluten Handlungen“ wirklich das Leid der Unschuldigen ausgleichen?
An diesem Punkt müssten wir uns die Schuhe ausziehen, wie Mose, der heiligen Boden betritt (vgl. Ex 3,1-5), weil wir dem persönlichen, unersetzbaren, unübertrefflichen (auf kein „absolutes Wissen“(31) verkürzbaren) Dialog beiwohnen zwischen dem Leidenden und dem „Zeugen des Absoluten“(32), der selber leidet, der hier und jetzt die Gegenwart des Göttlichen beweist (und nicht nur anzeigt), der das, was nicht zu rechtfertigen ist, noch übertrifft. Wie im Buch Ijob verwandeln wir uns in die Protagonisten der dramatischen Auseinandersetzung zweier Freiheiten von Angesicht zu Angesicht. Es könnten auch zwei Menschen sein, die an der gleichen Krankheit leiden und im gleichen Zimmer eines Krankenhauses liegen. Einer verzweifelt, der andere ist überraschend ruhig. Oder jeder von uns, der am 26. Mai diesen Jahres von der Ermordung der 29 Kopten auf der Halbinsel Sinai gehört hat, die sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören.
Seit der Autor des Buches Ijob diese erhabenen Seiten geschrieben hat, ist dieses Drehbuch, dessen Protagonisten auch wir sind, hunderttausende Male wieder geschrieben worden, und es wird noch unendlich oft neu geschrieben werden.
* Dieser Artikel erschien zuerst in spanischer Sprache im Juni 2017 auf www.jotdown.es, und auf Italienisch, in Tracce. Juli-August 2017-
(1) Vgl. https://borgestodoelanio.blogspot.com/2018/01/jorge-luis-borges-el-libro-de-job.html.
(2) P. Claudel, Das Buch Job, Bastion-Verlag, Düsseldorf 1948, S. 7.
(3) F. Dostojewskij, Die Brüder Karamasow. Aus dem Russischen von Swetlana Geier, Fischer Taschenbuch, Frankfurt/M 2006, S. 382.
(4) Ebd., S. 393.
(5) S. Kierkegaard, Die Wiederholung, in: ders., Die Krankheit zum Tode. Furcht und Zittern. Die Wiederholung. Der Begriff der Angst, dtv, München 82019, S. 408.
(6) J. Jiménez Lozano, „Arreglo de cuentas“, in: El tiempo de Eurídice, Fundación Jorge Guillen, Valladolid 1996, S. 200. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(7) C.S. Lewis, Über den Schmerz, Kösel, München 1978, S. 27.
(8) S. Kierkegaard, Die Wiederholung , a.a.O., S. 418.
(9) Vgl. Jorge Luis Borges, „El Libro de Job“. Conferencia en el Instituto Cultural Argentino-Israelí de Buenos Aires, 1965. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(10) M. Zambrano, „Das Buch Hiob und der Vogel“, in: Der Mensch und das Göttliche, Turia + Kant, Wien 2005, S. 310.
(11) S. Kierkegaard, Die Wiederholung, a.a.O., S. 423.
(12) Ebd., S. 314.
(13) P. Volz, Hiob und Weisheit (Die Schriften des AT in Auswahl III,2), Göttingen 1921, S. 1.
(14) M. Jastrow, The Book of Job, Philadelphia 1920, S. 76. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(15) L. Steiger, „Die Wirklichkeit Gottes in unserer Verkündigung“, in: M. Honecker - L. Steiger (Hrsg.), Auf dem Wege zu schriftgemäßer Verkündigung, München 1965, S. 160.
(16) E. Bloch, „Studien zum Buch Hiob“, in: M. Schlösser (Hrsg.), Für Margarete Susman: Auf gespaltenem Pfad, Darmstadt 1964, S. 90.
(17) R. A. F. MacKenzie, „The Purpose of the Yahweh Speeches in the Book of Job“, Bib 40, 1959, S. 436. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(18) G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1970, S. 290.
(19) M. Zambrano, Filosofía y Educación. Manuscritos, hrsg. von Á. Casado und J. Sánchez-Gey, Málaga 2007, S. 141. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(20) Ebd., S. 147.
(21) Ebd., S. 60.
(22) Vgl. P. Ricœur, „L’herméneutique du témoignage“, in Lectures 3. Aux Frontières de la philosophie, Paris 1994, S. 107-139.
(23) Vgl. J. Nabert, Eléments pour une éthique, Paris 1971, Kap. IV und V.
(24) Vgl. J. Nabert, Le désir de Dieu, Paris 1966, S. 213.
(25) Vgl. ebd., Buch II, Kap. IV.
(26) Vgl. ebd., S. 21.
(27) Vgl. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Meiner, Hamburg 1978; G.E. Lessing, „Über den Beweis des Geistes und der Kraft“, in: W. Barner u.a. (Hrsg.), Werke und Briefe, Bd. 8, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 1989.
(28) Vgl. J. Nabert, Essai sur le mal, Presses Universitaires de France, Paris 1955.
(29) P. Ricœur, „L’herméneutique du témoignage“, a.a.O., S. 137.
(30) J. Nabert, Ensayo sobre el mal, Madrid 1997, S. 145. Eigene Übersetzung aus dem Spanischen.
(31) Vgl. P. Ricoeur, „L’herméneutique du témoignage“, a.a.O., S. 137.
(32) Vgl. J. Nabert, Le désir de Dieu, a.a.O., Kap. I des III. Buchs.